Veröffentlicht in: Forum Wissenschaft (2013), Ausgabe 4/2013, Thema: Kritische Psychologie – work in progress. Verfügbar über: Vanessa Lux in Forum Wissenschaft 2013
Vanessa Lux
Die Suche nach den Genen für psychische Störungen ist mit dem Versprechen legitimiert worden, neue Behandlungsmöglichkeiten bereitzustellen. Doch gab es bislang weder eindeutige Gen-Funde noch wurden neue Therapieverfahren entwickelt. Vielmehr zeichnet sich ab, dass genetisches Wissen für die psychologische Praxis auch in Zukunft keine Rolle spielt. Die psychiatrische Genetik ventiliert hier nach wie vor überzogene Hoffnungen, wie Vanessa Lux kritisiert. Lesen extern fortsetzen →

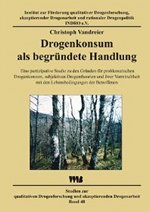 Problematischer Drogenkonsum wird nach wie vor häufig als „Krankheit“ oder „Sucht“ aufgefasst, deren Ursachen vor allem im einzelnen Individuum zu suchen sind. Der Autor entwirft demgegenüber ein Verständnis von Drogenkonsum als begründeter Handlung. Damit wird der Blick weg von individuellen Defiziten auf die problematischen Bedingungen gelenkt, die dem Konsum zugrunde liegen. In fünf Portraits nähert sich der Autor den Lebensbedingungen der Betroffenen und zeigt, wie sie mit dem Konsum von Drogen verknüpft sind. Dabei werden problematische gesellschaftliche Strukturen herausgearbeitet, in denen der Gebrauch psychoaktiver Substanzen verständlich und sinnvoll erscheinen kann. Der veränderte Blick auf die eigene Problemlage wird ebenso beschrieben, wie alternative Umgangsweisen. Einzigartig im Bereich der Drogenarbeit ist die enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen bei der Erstellung der Portraits. Indem sie in alle Schritte der Arbeit eingebunden waren, sie kritisieren und verändern konnten, entstand ein authentisches und sensibles Bild ihrer Probleme, das auch gleich wieder in der Praxis erprobt werden konnte. Das Ergebnis ist nicht nur eine lohnende Lektüre für alle professionellen Drogenhelfer, sondern kann auch Betroffenen und Angehörigen neue Perspektiven eröffnen.
Problematischer Drogenkonsum wird nach wie vor häufig als „Krankheit“ oder „Sucht“ aufgefasst, deren Ursachen vor allem im einzelnen Individuum zu suchen sind. Der Autor entwirft demgegenüber ein Verständnis von Drogenkonsum als begründeter Handlung. Damit wird der Blick weg von individuellen Defiziten auf die problematischen Bedingungen gelenkt, die dem Konsum zugrunde liegen. In fünf Portraits nähert sich der Autor den Lebensbedingungen der Betroffenen und zeigt, wie sie mit dem Konsum von Drogen verknüpft sind. Dabei werden problematische gesellschaftliche Strukturen herausgearbeitet, in denen der Gebrauch psychoaktiver Substanzen verständlich und sinnvoll erscheinen kann. Der veränderte Blick auf die eigene Problemlage wird ebenso beschrieben, wie alternative Umgangsweisen. Einzigartig im Bereich der Drogenarbeit ist die enge Zusammenarbeit mit den Betroffenen bei der Erstellung der Portraits. Indem sie in alle Schritte der Arbeit eingebunden waren, sie kritisieren und verändern konnten, entstand ein authentisches und sensibles Bild ihrer Probleme, das auch gleich wieder in der Praxis erprobt werden konnte. Das Ergebnis ist nicht nur eine lohnende Lektüre für alle professionellen Drogenhelfer, sondern kann auch Betroffenen und Angehörigen neue Perspektiven eröffnen.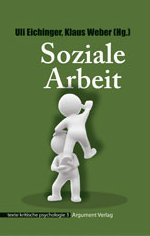 Die Kritische Psychologie bezieht Position für emanzipatorische gesellschaftliche Veründerungen und gegen eine herrschaftsförmige Praxis, die über Subjekte spricht statt mit ihnen. Diesem Band geht es um die Schärfung kritischer Selbstverständnisse in der Sozialen Arbeit. Er enthält gesellschaftsanalytische Beiträge u.a. zu Individualisierungstendenzen, widersprüchlichen gesellschaftlichen Anforderungen sowie Kapitalismus als Rahmenbedingung Sozialer Arbeit. Behandelt werden aktuelle Theoriestränge und Methoden der Sozialen Arbeit: die Herausforderungen Lebensweltbezogener Sozialer Arbeit, die Paradigmenvielfalt in der Sozialen Arbeit, politische Bildung, die Leerstellen von bewältigungs- und ressourcenorientierten Ansätzen und die Kritische Psychologie als Vermittlungstheorie.
Die Kritische Psychologie bezieht Position für emanzipatorische gesellschaftliche Veründerungen und gegen eine herrschaftsförmige Praxis, die über Subjekte spricht statt mit ihnen. Diesem Band geht es um die Schärfung kritischer Selbstverständnisse in der Sozialen Arbeit. Er enthält gesellschaftsanalytische Beiträge u.a. zu Individualisierungstendenzen, widersprüchlichen gesellschaftlichen Anforderungen sowie Kapitalismus als Rahmenbedingung Sozialer Arbeit. Behandelt werden aktuelle Theoriestränge und Methoden der Sozialen Arbeit: die Herausforderungen Lebensweltbezogener Sozialer Arbeit, die Paradigmenvielfalt in der Sozialen Arbeit, politische Bildung, die Leerstellen von bewältigungs- und ressourcenorientierten Ansätzen und die Kritische Psychologie als Vermittlungstheorie.